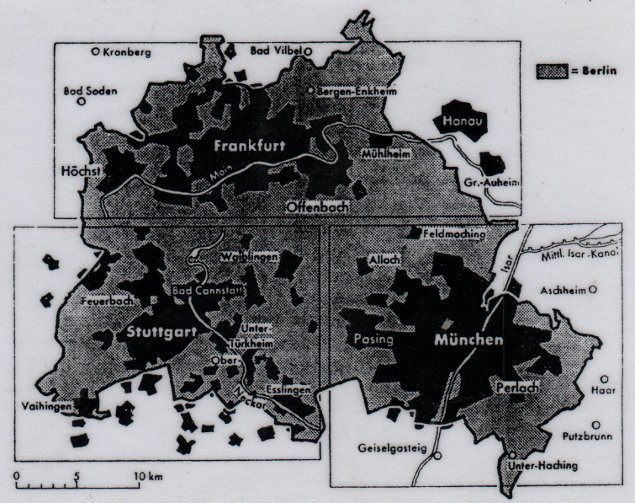Die Beförderungspflicht ist ja eine recht lustige Geschichte. Wir Taxifahrer sind mit unseren Taxis Teil des öffentlichen Nahverkehrs und wir haben damit einhergehend diverse Rechte und Pflichten, die uns von rein privaten Fahrbetrieben unterscheiden. Alles kann ich da beim besten Willen auch nicht aufzählen, will ich jetzt auch nicht. Aber das Recht, uns an Taxiständen und vor Veranstaltungen bereitzuhalten und die ermäßigte Mehrwertsteuer für die meisten Fahrten seien hier mal als Beispiele für Rechte genannt, die nicht jeder bekommt. Im Gegenzug dürfen wir unsere Preise nicht frei bestimmen und haben auch eine gesetzliche Vorgabe, wie lange wir das Taxi mindestens einsetzen müssen, um eine gewisse Verfügbarkeit zu garantieren. Und eben die Beförderungspflicht.
Innerhalb des Pflichtfahrgebietes (das in aller Regel zumindest weitgehend mit den Stadt- oder Landkreisgrenzen identisch sein wird) müssen wir Fahrgäste befördern. Im Alltag gibt es dazu fast ausschließlich Ärger um die berühmten kurzen Fahrten, die manche Kollegen gerne ablehnen, weil sie es nicht schaffen, mal kurz eine bittere Pille zu schlucken und über den eigenen Tellerrand zu schauen. Das Pflichtfahrgebiet ist hier genauestens definiert und so lange der Startpunkt in Berlin liegt, ist die Stadtgrenze auch die Grenze des Pflichtfahrgebietes – mit Ausnahme des Flughafens, da dürfen wir auch nicht ablehnen. Vom Flughafen aus existiert ein anderes Pflichtfahrgebiet, das noch einige umliegende Gemeinden und Landkreise mit einschließt, aber da ich dort bislang nicht lade und sowieso kein Problem mit Touren nach außerhalb habe, ist das in meinem Interesse ziemlich weit hinten. Ich würde überhaupt nur Touren ablehnen, bei denen ich in Konflikt mit meinem Tankinhalt oder der Arbeitszeitbegrenzung kommen würde. Und beides ist so extrem selten, dass ich das aus meinen Gedanken völlig ausklammern kann.
Was ich mich allerdings oft schon gefragt habe – und ich habe bisher wirklich keine Antwort darauf – WO und WANN unsere Pflichten eigentlich gelten. Das lässt mich in der Praxis meist kalt, weil ich ehrlich froh um jeden einzelnen Kunden bin und sich die Frage, ob ich eine Fahrt annehmen muss, damit erübrigt. Die Ablehnungen aufgrund Gefährdung der Sicherheit halten sich auch in sehr engen Grenzen bei mir, da lässt man das auch gerne mal gedanklich wegfallen.
Deswegen, vor der kurzen Anekdote, eine Frage an die mitlesenden Kollegen:
Wie ist das eigentlich: Gilt die Beförderungspflicht nur für bestellte Fahrten und Fahrten am Stand, oder ebenso wenn ich mit angeschalteter Fackel an der Ampel stehe? Dass man in der Praxis auch Leute mal „übersieht“ und das damit umgehen kann, ist mir schon klar. Ich mach das ja auch nicht erst ein paar Wochen 😉
Aber rein rechtlich so?
Bevor ich (hoffentlich) eine Antwort darauf kriege, wechseln wir mal wieder rüber in die kleine 1925 und versetzen uns in eine wirklich wunderschöne Situation: Ich hatte meine Schicht am Wochenende nach langem mal wieder vollkommen durchgerockt. Die Arbeitszeit war zwar noch verhältnismäßig human, aber von Abends bis morgens hatte ich viel Kundschaft, meist sogar nette. Die Uhr stand nahe der Sechs, das Taxameter weit jenseits der 200 €. Meine – wie ich hoffte – letzte Tour führte etwas unpraktisch in den Westen, was einen längeren Rückweg zum Abstellplatz in Lichtenberg bedeutete. In solchen Momenten muss man sich immer entscheiden, ob man satt ist oder doch Hure und in 90% aller Fälle entscheide ich mich für zweiteres. Ich lasse die Fackel noch an, entwickle aber Tendenzen dazu, ans Schicksal zu glauben und daran, dass jetzt nur noch Fahrgäste winken, die in die richtige Richtung wollen. Zumindest so halbwegs.
Während ich also extrem gechillt und mit ausreichend lauter Musik am Start die Leipziger Straße in Richtung Alexanderplatz langgegurkt bin, überholt mich ein Kollege. War aber ok, er war besetzt. Nicht wirklich ok war das Tempo, aber obwohl ich anfänglich schon einen fragenden Blick aufsetzte, hab ich mal die Welt Welt sein lassen. Ja, wahrscheinlich hatte er die Punktegrenze hinter sich gelassen, aber dann riskiert er halt Ärger. Die Leipziger Sonntags um 6 Uhr lädt zum Heizen ein, deswegen alleine musste er noch nicht wirklich ein Vollpfosten sein. An die 30 km/h auf Höhe der Baustelle achtete auch ich nicht im Entferntesten.
Wie aber so oft brachte das schnelle Fahren nicht viel, wir landeten an der Ampel an der Fischerinsel auf gleicher Höhe nebeneinander. Während ich die Lichtzeichenanlage mit mäßiger Begabung versuchte telepathisch auf grün zu schalten, nahm ich eine Bewegung im Auto neben mir war. Der Kollege bedeutete mir, die Scheibe runterzulassen.
„Naja, eine Frage nach einem Zielpunkt, einem Club vielleicht.“
dachte ich mir. Nicht jeder Taxifahrer kommt in Berlin jede Nacht überall vorbei, da tauscht man sich auch mal kurz auf der Straße aus. Man sitzt ja im selben Boot und wenigstens in solchen Momenten ist noch was da von der Solidarität unter Kollegen. Also hab ich die Musik ausgemacht und gelauscht. Und der Kollege fragte allen Ernstes:
„Sag mal, willste nach Spandau fahren? Der eine hier müsste nach Spandau, wär aber für den anderen ein Umweg.“
Das betrifft die obige Frage natürlich nicht. Die Gedanken hab ich mir erst später gemacht. Natürlich kann ein Kollege einmal erworbene Fahrgäste nicht einfach so zu mir abschieben. Aber in der Form hatte ich das noch nicht in all der Zeit bisher. In dem Fall war der Kollegen aber definitiv an einen etwas zu müden Sash geraten, denn bei allem Leuchten in meinen Augen ob der hochwahrscheinlichen 300 auf der Uhr nach dieser Fahrt, graute es mir davor, jetzt kehrt zu machen, und schnell mal 10 bis 15 Kilometer Richtung Westen zu gurken. Dass er noch einen gefunden hat, hoffe ich ja. Ansonsten hat es sich ja wenigstens finanziell gelohnt. Und wenn es im Einzelfall das Pflichtfahrgebiet ist, das uns dazu zwingt: am Ende machen wir für unser Geld ja dann doch alles.